FlexLink im Gespräch: Materialfluss, Linienintegration und Ergonomie in der SMT-Fertigung


Materialfluss, Ergonomie, Integration
SMT-Fertigungen stehen vor einem paradoxen Problem: Die Linien sind hochautomatisiert, doch oft stockt die Produktion an kleinen Details im Materialfluss. Transportprobleme, fehlende Puffermodule oder unzureichende Rückverfolgbarkeit können genauso teuer werden wie Maschinenausfälle.
Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir diese Engpässe auflösen. Dafür haben wir mit Christian Werner, Business Development Manager PCB / Electronics DACH bei FlexLink, gesprochen. Er erklärt, warum Linienintegration, ergonomische Arbeitsplatzmodule und intelligente Puffersysteme entscheidend sind – und wie die Zusammenarbeit mit CTS Fertigungen stabiler und wettbewerbsfähiger macht.
Fokus: Fördertechnik, Puffermodule, Lasermarker, Ergonomie, Linienintegration
Ihr neues System setzt auf berührungslose Kennzeichnung. Welche konkreten Fehlerquellen im Alltag werden dadurch eliminiert?
Noch immer setzen viele Elektronikfertiger auf das klassische Labeln am Bestückmodul – ein Verfahren, das mehr Probleme mit sich bringt, als es löst. „Labels verlangsamen den Linientakt, sind nicht besonders haltbar und werden oft erst spät in der Linie angebracht“, erklärt Christian Werner. Damit ist eine vollständige Rückverfolgbarkeit kaum möglich – und über die Jahre summieren sich zudem hohe Kosten für Verbrauchsmaterial.
Mit dem neuen Lasermarkiersystem 1-LV-R geht FlexLink einen anderen Weg: Die berührungslose Markierung erfolgt direkt am Anfang der Linie. Die Laserquelle nutzt sich nicht ab und bringt Codes jeder Art dauerhaft und prozesssicher auf die Leiterplatten auf. „Das spart langfristig nicht nur Geld, sondern bietet unseren Kunden auch die Flexibilität, die sie für wechselnde Anforderungen in der Produktion brauchen“, so Werner.
Ihre dreistufige Aushubstation kann defekte Leiterplatten direkt aus dem Fluss entfernen. Was bedeutet das für Yield und Taktzeitstabilität?
Ein häufiger Störfaktor in SMT-Linien: Defekte Leiterplatten blockieren den Materialfluss und bringen den Takt ins Wanken. FlexLink begegnet diesem Problem mit einer dreistufigen Gut-/Schlecht-Aushubstation. „Der Linientakt bleibt stabil – und gleichzeitig erhöht sich der Yield“, erklärt Christian Werner.
Die erweiterte Aufnahmekapazität verschafft dem Bediener wertvolle Zeit, um Fehler zu analysieren und den Prozess zu stabilisieren, ohne dass die gesamte Linie ins Stocken gerät. Ein zusätzlicher Vorteil: Im Vergleich zu großen Puffertowern ist die Lösung deutlich kosteneffizienter.
Ihr FIFO-Puffermodul reguliert die Abkühlung nach dem Reflow. Warum ist die präzise Kühlung Grundvoraussetzung für Qualität und Nacharbeit?
Die Qualitätskontrolle in SMT-Linien hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Moderne 3D-AOI-Systeme arbeiten hochauflösend und zuverlässig – finden aber auch kleinste Abweichungen. „Mit heutigen AOIs entdeckt man das sprichwörtliche Haar in der Suppe schnell, prozesssicher und effektiv“, erklärt Werner.
Diese Empfindlichkeit hat jedoch eine Kehrseite: Schon kleinste Störeinflüsse, etwa durch zu hohe Temperaturen der Leiterplatten nach dem Reflow, können falsche Fehlerergebnisse erzeugen. „Deshalb muss man sehr genau darauf achten, dass die Boards ausreichend heruntergekühlt werden, bevor sie ins AOI gehen“.
An diesem Punkt kommt das FIFO-Puffermodul ins Spiel. Es ergänzt die Kühlzonen des Ofens und gibt dem Operator die Möglichkeit, die Kühlzeit jedes einzelnen Boards individuell einzustellen. „So verhindern wir Pseudofehler und stellen sicher, dass die AOI-Ergebnisse verlässlich sind – ohne unnötige Nacharbeit und ohne Abstriche bei der Prozesssicherheit.“
Ihr Arbeitsplatzmodul verbindet Automatisierung und Ergonomie. Welche Bedeutung hat die Mensch-Maschine-Schnittstelle für die Zukunft moderner SMT-Linien?
Künstliche Intelligenz hat Inspektionssysteme in der SMT-Fertigung in den letzten Jahren enorm verbessert. Doch trotz aller Fortschritte gilt: Ohne den Menschen geht es nicht. „So gut moderne Inspektionssysteme durch die KI auch geworden sind, es ist immer noch der Mensch, der diese Maschinen anlernt“, sagt Christian Werner.
Auch vermeintlich perfekte Systeme machen Fehler – und am Ende ist es der Facharbeiter, der kontrolliert, korrigiert und Qualität sicherstellt. „Nur so bleibt die Ausbeute konstant hoch“, betont er.
Mit ergonomisch gestalteten Arbeitsplatzmodulen verbindet FlexLink Automatisierung und Handarbeit. Hier können Mitarbeiter inspizieren, nachbestücken und Bauteile kontrollieren – ohne dass der Arbeitsfluss leidet. „So weit die Automatisierung auch ist, den gut ausgebildeten Facharbeiter kann man so schnell nicht ersetzen“, sagt Werner.
Welche technischen Schnittstellen sind die größten Stolpersteine in heutigen SMT-Linien – und wie adressieren Sie diese mit modularen Konzepten?
Kaum ein Produktionsleiter kommt ohne sie aus, und doch sind sie die größte Fehlerquelle: Schnittstellen. „Wir begegnen täglich einer Vielzahl davon“, erklärt Christian Werner. „Da gibt es hoch standardisierte und bewährte Schnittstellen, neue, die erst noch ein Standard werden wollen, proprietäre Lösungen von Drittanbietern und schließlich kundenspezifische Anbindungen an ERP- oder MES-Systeme.“
Gerade im Leiterplattenhandling und in der Verkettung entscheidet sich an diesen Übergängen, ob eine Linie stabil läuft oder ins Stocken gerät. FlexLink adressiert diese Komplexität bewusst modular. „Unsere Systeme sind so aufgebaut, dass wir je nach Anforderung mit standardisierten oder individuellen Lösungen arbeiten können. Dadurch verbinden wir Prozesse nahtlos miteinander und übernehmen in der horizontalen Kommunikation eine führende Rolle.“
Wo sehen Sie europäische Elektronikfertiger im Vergleich zu Asien und den USA – und welchen Beitrag leistet Ihre Technik, um international wettbewerbsfähig zu bleiben?
Die Anforderungen an Elektronikfertiger unterscheiden sich weltweit drastisch. „In Mitteleuropa wird viel Engineering betrieben und vor allem Kleinserien gefertigt. In Asien dagegen dominiert die Großserienproduktion – oft über Jahre hinweg mit denselben Produkten, ohne dass die Linie je umgestellt wird“, erklärt Christian Werner.
Auch beim Personal zeigt sich ein Unterschied: Während in Europa hochqualifizierte Fachkräfte an den Linien arbeiten, ist der Ausbildungshintergrund in Asien meist niedriger. Das wirkt sich auf die Anforderungen an die Technik aus. „Europäische Fertigungen brauchen hochflexible Systeme, die sehr schnell gerüstet werden können – nicht zuletzt, weil die Lohnkosten deutlich höher sind.“
Sicherheit und Flexibilität spielen in Asien oft eine geringere Rolle, dafür steht die Effizienz in der Massenproduktion im Vordergrund. „Wir kennen diese Unterschiede aus unserer täglichen Arbeit und entwickeln Systeme, die auf beide Welten passen. Aber die Anforderungen könnten kaum unterschiedlicher sein.“
Fokus: Linienintegration & Materialfluss
Ihre Aushubstation kann bis zu drei fehlerhafte Leiterplatten gleichzeitig entnehmen. Wie groß ist der Unterschied im Durchsatz, wenn das im Alltag nicht passiert – und wie merken Produktionsleiter diesen Engpass sofort?
In SMT-Linien sind es oft nicht die großen Defekte, sondern kleine Störungen, die teuer werden. Ein Beispiel: defekte Leiterplatten, die nicht rechtzeitig aus dem Prozess entnommen werden. „Wenn der Bediener gerade an anderen Modulen eingespannt ist oder Magazine belädt, kann das sehr schnell zu einem Linienstopp führen“, erklärt Christian Werner.
Mit einer dreistufigen Aushubstation lässt sich dieses Risiko deutlich reduzieren. Sie nimmt mehrere fehlerhafte Boards gleichzeitig auf, stabilisiert damit den Materialfluss und verhindert, dass der Durchsatz einbricht. Für Produktionsleiter ist der Unterschied sofort sichtbar: statt ungeplanter Stopps bleibt der Takt konstant – und die Linie produktiv.
Beim FIFO-Puffer: Inwiefern hängt die Qualität nach dem Reflow direkt davon ab, ob die Boards richtig „abkühlen“ – und wie viele Nacharbeiten lassen sich damit vermeiden?
Auf den ersten Blick scheint die Temperatur der Leiterplatten nach dem Reflow-Prozess kein großes Thema zu sein. Tatsächlich entscheidet sie aber darüber, wie stabil eine Linie läuft. Werden Boards nicht ausreichend heruntergekühlt, steigt die Zahl der Pseudofehler am AOI sprunghaft an.
„Es schadet den Boards selbst nicht direkt, wenn sie zu warm ins AOI gehen. Aber die Prüfsysteme reagieren extrem sensibel“, erklärt Werner. Das Ergebnis: falsche Fehlermeldungen, zusätzlicher Prüfaufwand und unnötige Nacharbeit.
Ein FIFO-Puffer mit integrierter Kühlung wirkt hier wie ein Stabilisator. Er sorgt dafür, dass die Boards mit der richtigen Temperatur in die Inspektion gehen – der Linientakt bleibt konstant, die Pseudofehlerrate sinkt und der Output steigt.
Viele Linien stoppen wegen kleinerer Transportprobleme. Wo sind in der Praxis die größten Schwachstellen im Materialfluss – und wie haben Sie die technisch adressiert?
Nicht immer sind es komplexe Fehler, die eine SMT-Linie zum Stillstand bringen. Oft reicht schon eine kleine Ursache. „Viele wollen es nicht glauben, aber die meisten Transportprobleme entstehen schlicht dadurch, dass sich Maschinen oder Module unbemerkt verschieben“, erklärt Werner. Ein typisches Szenario: Ein Mitarbeiter lehnt sich an ein Transportmodul, das nicht fixiert ist – und schon bleibt die Leiterplatte am Übergang hängen.
Die Folge: Der Materialfluss stoppt, die Linie steht. Technisch lässt sich dieses Risiko einfach und dauerhaft vermeiden. „Unsere Empfehlung ist, die Module fest im Boden zu verankern. Verdübelung klingt banal, verhindert aber zuverlässig, dass sich Prozesse wegen solcher Kleinigkeiten unterbrechen“, so Werner.
Fokus: Kooperation in Projekten
Viele Projekte scheitern an Schnittstellen: Der Maschinenlieferant schiebt die Schuld auf den Fördertechniker, der auf den Automatisierer. Wie stellen Sie sicher, dass diese Diskussion bei Ihnen nicht entsteht?
Wenn Projekte ins Stocken geraten, liegt die Ursache selten in der Maschine selbst – sondern fast immer an den Schnittstellen. Klassisches Szenario: Der Maschinenlieferant verweist auf den Handling-Hersteller, dieser wiederum auf den Automatisierer. Am Ende bleibt der Fertiger mit einer stillstehenden Linie zurück.
„Genau das vermeiden wir, indem wir Schnittstellen klar und verbindlich definieren“, erklärt Werner. Auf horizontaler Ebene gelten Standards, die keinen Interpretationsspielraum lassen. Und wo Sonderlösungen nötig sind, setzt FlexLink auf frühe Abstimmung mit allen beteiligten Drittparteien. „Wir testen solche Schnittstellen intensiv, bevor die Maschinen überhaupt beim Kunden ankommen. So stellen wir sicher, dass Integration nicht zum Risiko wird.“
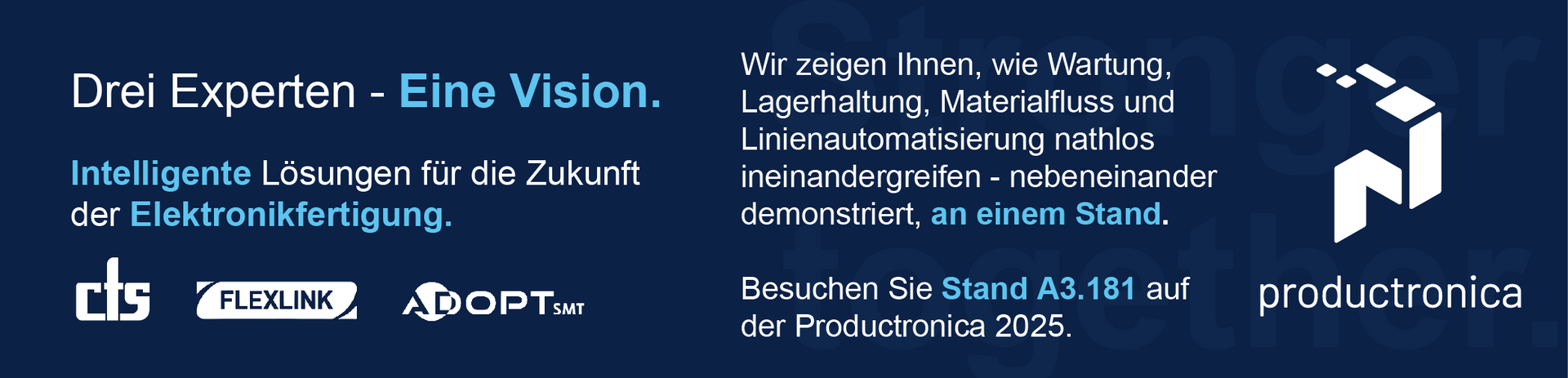
Wenn eine Linie stillsteht: Wer übernimmt die Verantwortung – und wie regeln Sie das zwischen AdoptSMT, FlexLink und CTS?
Wenn eine Linie stillsteht, ist für den Fertiger vor allem eines entscheidend: schnelle Hilfe. Wer am Ende formal verantwortlich ist, spielt in diesem Moment eine untergeordnete Rolle. „Es gibt zahlreiche Konstellationsmöglichkeiten, wie Verantwortung verteilt wird – doch entscheidend ist, dass der Service funktioniert“, erklärt Werner.
FlexLink versteht sich hier als Hersteller, der den Außendienst bei der richtigen Maschinenauswahl unterstützt, in der Beratung präsent ist und auch nach dem Kauf im Service zur Seite steht. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit CTS und AdoptSMT: Jeder Partner bringt seine eigene Stärke ein, ohne dass der Kunde drei verschiedene Baustellen managen muss. „Für den Fertiger ist es im Grunde egal, bei wem er kauft – die Beratung, der Support und letztlich der Service greifen ineinander. Gerade in dieser Dreier-Konstellation sind wir extrem schlagkräftig.“
Aus Kundensicht: Was ist der spürbare Vorteil, wenn er drei Spezialisten in einem Team bekommt – statt drei Angebote und drei Ansprechpartner?
Für Fertiger macht es einen großen Unterschied, ob sie drei getrennte Angebote koordinieren – oder ein eingespieltes Team an ihrer Seite haben. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir nicht nur als Team auftreten, sondern auch so handeln“, sagt Werner.
Jeder Partner bringt sein Spezialgebiet ein: AdoptSMT mit Ersatzteilen und Refurbishment, CTS mit Lager- und Intralogistiklösungen, FlexLink mit Linienintegration und Handling. Anstatt nebeneinander zu arbeiten, greifen die Kompetenzen ineinander. „So bekommen unsere Kunden den bestmöglichen Support – weit über die Einzellösung hinaus. Genau das macht unsere Partnerschaft einzigartig und schafft einen Mehrwert, den man allein nicht erreichen könnte.“
Fokus: Standort Europa & Wettbewerbsfähigkeit
In Europa sind Linien oft kleiner und Stückzahlen variabler als in Asien. Welche technischen Unterschiede braucht eine europäische Fertigungslinie, um rentabel zu laufen?
Der direkte Vergleich zeigt: Europäische SMT-Fertigungen unterscheiden sich grundlegend von denen in Asien oder den USA. Während dort große Serien über lange Zeiträume laufen, dominieren hier kleinere Aufträge und häufige Produktwechsel. „Das bedeutet: Unsere Linien müssen deutlich flexibler sein und sich schneller umrüsten lassen“, erklärt Werner.
Hinzu kommen höhere Lohnkosten in Europa, die den Druck auf Effizienz zusätzlich erhöhen. Variabilität ist daher kein Nice-to-have, sondern Voraussetzung für Rentabilität. „Wir setzen auf intelligente Softwarelösungen, die Produktumstellungen automatisieren und den Rüstaufwand massiv reduzieren.“
Das Ergebnis: Europäische Fertiger bleiben trotz kleinerer Serien und höherer Kosten wettbewerbsfähig – nicht durch reine Geschwindigkeit, sondern durch die Fähigkeit, flexibel und präzise auf wechselnde Anforderungen zu reagieren.
Welche Rolle spielt Automatisierung in einem Hochlohnland – ist es Kostenreduktion oder eher Risikominimierung gegen Fachkräftemangel?
In Hochlohnländern wie Deutschland oder den USA ist Automatisierung längst mehr als eine Frage der Effizienz. „Natürlich steht die Kostenreduktion im Vordergrund – die höheren Investitionen in automatisierte Systeme amortisieren sich schnell durch weniger Personaleinsatz“, sagt Werner.
Doch die Realität in den Fabriken zeigt: Es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um den Mangel an Fachkräften. „Früher standen gut ausgebildete Elektroniker an der Linie. Heute sind es oft umgeschulte Friseurinnen oder Bäcker. Mit hochautomatisierten Systemen können auch sie nach einer kurzen Einweisung die Prozesse zuverlässig bedienen.“
Automatisierung wird damit zum doppelten Hebel: Sie senkt Kosten – und gleicht gleichzeitig die Lücken aus, die der Arbeitsmarkt immer deutlicher hinterlässt.
Sehen Sie in der Praxis, dass Kunden heute eher „Step by Step“-Lösungen (z. B. erstmal ein Smart Warehouse) bevorzugen, statt sofort in die Vollautomatisierung zu gehen?
Viele Fertiger stellen sich die Frage: Alles auf einmal automatisieren – oder lieber in Etappen? „Man sollte nichts überstürzen. Der Weg in die Smart Factory funktioniert am besten Schritt für Schritt“, sagt Werner.
Ein Masterplan sei zwar wichtig, doch die Erfahrung zeigt: Projekte verändern sich unterwegs, Prioritäten verschieben sich. „Deshalb ist es sinnvoll, zunächst mit einem Smart Warehouse zu starten und die Ein- und Ausgabegeräte an den Linien sukzessive auszutauschen oder umzurüsten. Magazine können anfangs noch manuell transportiert werden – und später folgt der AMR.“
Dieser Ansatz schont nicht nur das Budget, sondern hält die Fertigung flexibel. Wer so vorgeht, bleibt handlungsfähig, auch wenn sich Marktbedingungen ändern – und baut die Smart Factory auf einem stabilen Fundament auf.


